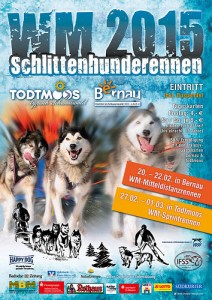Wo sind die echten Huskies ??
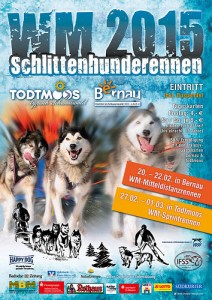
Die Schlittenhunde WM in Deutschland, genauer Todtmoos, führt derzeit wieder zu der alljährlichen Diskussion, die immer geführt wird, wenn jemand von so einem Event zurückkommt, oder dabei war.
Am Plakat sieht man die wunderbaren nordischen Hunde, die vor dem Schlitten ihre Arbeit verrichten, und mit dem “Alaska-Feeling” die Besucher anlocken soll. Meist gelingt das auch recht gut. Doch die Enttäuschung folgt auf dem Fuß. Zu sehen gibt es heutzutage fast nur mehr das:

Jagdhunde vor dem Schlitten. Sie haben aber auch gar nichts mit den Fellwuscheln zu tun, die man normalerweise kennt, und erwartet. Doch hier einmal der komplette Bericht aus der Stuttgarter Zeitung zum Lesen:




Klickt die einzelnen Grafiken an, um die Ausschnitte lesen zu können!
Das Zitat: “An einem Stand gibt es Mützen, mit denen man aussieht wie ein Husky. Wo sind die echten Huskys? Die Hunde, die hier rumsitzen, rumspringen und beim Rumbubeln einander an den Schnauzen knabbern, sehen alle aus wie mittelgroße Jagdhunde mit wenig Fell. Keine Spur von den Polarspitzen, die einst mit Roald Amundsen den Südpol eroberten, mit den Inuit seit Jahrtausenden auf Bärenjagd gehen und die sibirischen Nomaden auf dem richtigen Weg halten, wo sich der menschliche Orientierungssinn längst auflöst.”, sagt nun aber auch schon sehr viel zur Erwartung der Besucher, und mittlerweile auch der Medien zu so einer Veranstaltung aus …
Als “Schlittenhundler” der selbst reinrassige Nordische hat (und dabei zählt nicht das Zuchtpapier, sondern das Aussehen nach FCI-Standard!), und auch als Präsident des NSSV – Niederösterreichischer Schlittenhunde Sportverein, habe ich die Entwicklung auf den Trails die letzten 10 Jahre genau beobachtet. Man kann sich aber auch nicht vorstellen, welchen Streit das auch immer gegeben hat, wenn wir auf Events pochten, die reinrassig geführt wurden, und nicht vermischt mit den “offenen”.
Zur Erklärung: Die “Reinrassigen” sind die 4 anerkannten FCI Schlittenhunderassen. Der Alaskan Malamute, der Siberian Husky, der Grönländer und der Samojede. Nicht anerkannt aber den reinrassigen fast gleich ist der Alaskan Husky. Dieser Hund ist im Prinzip auch ein Mischling, aber noch eher zu den Nordischen zu zählen als alles was danach kam, nämlich den sogenannten “Offenen” zu denen die German Trail Hounds, die Skandinavian Hounds und sonstige “Jagdhunde” zählen. Von den Leuten mit den Nordischen auch “Plutos” genannt, werden von beiden Seiten keine Kosewörter für die Hunde der jeweiligen anderen Fraktion verwendet.
Doch warum ist das so? Wieso werden die echten Nordischen immer mehr verdrängt, und warum klappt ein gemeinsam zwischen diesen beiden Fraktionen nur selten?
Angefangen hat eigentlich alles mit der Bike- und Scooterszene vor X-Jahren. Irgendwann wurden neben den nordischen Hunden auch andere Rassen zugelassen, weil es ja im Prinzip um nichts ging. Um Teilnehmer zu bekommen, und Startgelder zu lukrieren, wurde das Teilnehmerfeld eben erweitert. Zu diesem Zeitpunkt liefen vor dem Schlitten maximal Alaskan Huskies in der Klasse 3. Vereinzelt auch andere Hunderassen, die eben für den Hundeschlitten geeignet waren.
Dann kam man aber sehr schnell drauf, dass einige Hunde auf “Speed” getrimmt waren, und die Nordischen um Längen schlugen. Auch drängten dann die ersten “Plutos” direkt in den Schlittenhundesport, was natürlich Neid und Missgunst schürte. Man sah eigentlich damals schon den Unterschied zwischen den Hundehaltern selbst, deren Einstellung zu den Tieren, deren Prioritäten, und wie sie allgemein alles angingen.
Nun begann auch die große Veränderung bei den Huskies selbst. Immer mehr erstklassige “Züchtungen” drängten nun auf die Trails. Mittlerweile ging es nur mehr darum, die Hunde schneller zu machen, und die Plutos am Trail einzuholen. Die Behauptung, es seien trotzdem reinrassige Schlittenhunde ist eigentlich schon lange eine Farce. Ja, am Zuchtpapier sind sie es, wie auch immer sie dieses bekommen haben, aber laut Rassestandard sind sie es schon lange nicht mehr! Laut FCI-Rassestandard dürfte es nicht einmal eine Rennlinie oder getrennte Showlinie geben!
Der Geschwindigkeitsrausch auf den Rennen wurde nun auf dem Rücken der Tiere ausgetragen. Während man in die Hounds praktisch reinzüchten konnte, was man wollte, um einen schnellen Hund zu bekommen, klappte das bei den Huskies nicht. Man musste eben mit Druck am Tier die Geschwindigkeit erhöhen. Mit allen gesundheitlichen Nachteilen oder Zuchttricks die man auszuschöpfen versuchte.
Doch was unterscheidet die beiden Lager wirklich so voneinander?
Der echte “Nordischen Musher”, wie man die Schlittenhundeführer nennt, sagt ja immer wieder aus, ihm gehe es nur um den Spaß an der Sache. Mit den Hunden draußen unterwegs zu sein, die Natur und die Kraft der Hunde zu spüren. Ein Team zu bilden, und eben den Trail zu bezwingen. So weit, so einleuchtend.
Es gehe nicht ums Altmetall oder den Stockerlplatz beteuert man immer wieder (Warum fährt man dann auf EM’s und WM’s? Taktiert wie Sau, nur um an das Teil am Bändchen, die Urkunde oder den Pisstopf ranzukommen?). Dieser Typus von Schlittenhundler hat seine Regeln, die er einhält (Sagt er …). Die Hunde sind am Stake-Out fixiert oder in den Boxen. Gassi-gehen ist ein Tabu, die Hunde sollen sich am Stake-Out erleichtern. Angeblich ziehen Gassi-Geh-Hunde ja nicht mehr, wenn sie sich mal daran gewöhnt haben (So ein Schwachsinn!). Gefüttert wird nach Uhrzeit (das Fressen im Napf würde oft nicht mal ein Schwein fressen, aber alle machen es so) … Fleischsuppe nennt man das. Man brauche das zum Wässern vor dem Start und danach (Klar, ich würde auch gerne mit vollgesoffener Wampe laufen gehen, und das gluckern in mir hören!). Freilauf der Hunde ist ein NoGo am Stake-Out! Gut da gebe ich den Mushern recht, denn sonst wären Beißereien vorprogrammiert. Nordische sind nicht die Kuschelhündchen, als die man sie gerne darstellt! Auch den sogenannten “Welpenbonus” gibt’s nicht, außer im eigenen Rudel! Kleinhunde? Ein Happerl zwischendurch! Sie werden nicht als Artgenosse erkannt. Die Hunde parieren aufs Wort wenns um die Kommandos Go (Lauf!), Gee (Rechts) oder Haw (Links) geht. Beim Bremsen oder Stoppen klappts oft schon nicht mehr so ganz gut. Sitz, Platz, Komm her? Fehlanzeige. Egal, meine Hunde waren auch so “erzogen”. man arrangiert sich einfach mit den Hunden und das Team klappt.
Der “Pluto-Musher” ist jener Typus Hundesportler, der verbissen seine Hunde trimmt, wo alles passen muss, man sich nur das Beste vom Besten beim Material gönnt. Klar, man muss zeigen, dass man besser als alle anderen ist! Sobald diese Schlittenhundler am Trail sind, zählt nur mehr Geschwindigkeit! Der Trail darf keine engen Kurven haben, keine Auf- und Abpassagen in kurzer Reihenfolge, eigentlich nichts, was die Hunde stören oder bremsen könnte. Wenn ein “Nordischer Musher” vorne auftaucht, wird meist schon hysterisch “Trail, Trail, Traaaaiiill!! Stoooooppp!” geschrieen, weil man vorbei will, und nicht gewillt ist Geschwindigkeit raus zu nehmen. Wenn was schief läuft am Trail, ist weder “Supermusher” noch die Hunde schuld, sondern die Strecke oder der Veranstalter (Komischerweise haben früher, zu meinen Anfangszeiten, die Offenen nie selbst einen Trail angelegt oder einen Event veranstaltet, sondern sind immer als Trittbrettfahrer aufgetreten, und stellten Forderungen). Der Drang nach Titel, Pokalen und Stockerplätze ist die Triebfeder dieser Trailspezies. Am Stake-Out geht’s dafür anders zu. Die Hunde dürfen frei herumlaufen, Welpen werden herumgereicht, gefüttert wird derselbe Dreck, und auch gewässert wird wie beim Abfüllen von Weinfässern …
Die Einsatzzeit von Nordischen Hunden im Rennbetrieb ist in der Regel von 15 Monaten bis 10 Jahren (wenns hoch hergeht, und man zum Schluss eher Touren fährt), meist sind die Hunde mit 8 Jahren “verbraucht” und haben Gelenksprobleme. Bei der überwiegenden Anzahl von Mushern dürfen die Hunde dann auch ihren Lebensabend verbringen, und Futter, Pflege und Tierärzte verbrauchen, auch wenn sie keine Leistung mehr erbringen können. Einige Hunde werden ins Tierheim abgeschoben weil man sich die kosten sparen will. Wenige Hunde sterben schön während des Rennbetriebes. Aus welchen Gründen auch immer.
Bei den Offenen kann man beobachten, dass die Hunde bereits mit 12 Monaten in vollem Training “angeheizt” werden, und mit 6-7 Jahren dann eben “verheizt” sind. Komischerweise verschwinden diese Hunde dann irgendwie von der Bildfläche. Man sieht eigentlich in den meisten offenen Kennels keine alten Hunde, und auch in den Tierheimen gibt’s keine Hounds oder ähnliche! Ich werde dazu nun keine weitere Bemerkung schreiben, aber viele werden mir zu dieser Aussage recht geben.
Es gibt sie also, diese Unterschiede zwischen den beiden Lagern. Doch die sind imaginär. Der größte und auch alle Streitereien auslösende Unterschied liegt in der Einstellung und Gesinnung der Schlittenhundler beider Lager! Die Charaktere sind offensichtlich nicht vereinbar! Wenn man heute als Veranstalter sagt, man wolle keine Hounds starten lassen, weil es ein reinrassiges Rennen werden soll, wird man sofort mit der Rassismuskeule gepeinigt! Es kann doch nicht sein, dass man Hunde aufgrund ihrer Rasse von einem Event ausschließt!! Im Gegenzug wollen die Offenen aber freie Bahn auf den Trail der Nordischen, und damit die langsameren Huskies, Mützen, Sammys und Grönis weg … Wo also liegt der Unterschied?
Größenwahn, Machtgelüste, Geldgier … das haben beide Gruppierungen! Wenn es darum geht mit einem Verband die anderen flach zu halten, nur um einen Vorteil daraus zu ziehen, sind die Ideen von beiden Seiten sehr einfallsreich. Das die Schlittenhundeszene im Prinzip nur aus ein paar Familienclans bestehen, braucht man nicht näher zu erwähnen. Jeder weiß es, keiner spricht darüber. Man will ja keine Feinde haben.
Ich selbst erlaubte mir einmal folgende Aussage im Jahre 2006:
“Ich sehe es als Nachteil, wenn man reinrassig und offen mischt! Wozu sollte man das tun? Es gibt eben reinrassige Rennen und offenen Rennen und jeder kann und soll hinfahren wo er will!”
Dafür wurde ich fast gesteinigt … und zwar von jenen, die mittlerweile noch immer versuchen, die Schlittenhundevereine in Österreich unter einen Dachverband zu bekommen, aber unter der Kontrolle der “offenen”! Leute, das wird’s nie spielen! Vergesst doch einmal Euren Größenwahn und die ewigen Aufzwickereien Eurer Gedankenmuster! Es hat deswegen seit Anbeginn des Schlittenhundesports in Österreich gekracht, und der Streit wurde nie beendet! Jeder Verein hat das Recht dazu, eigenständig zum Wohl des Sports und zum Wohl der Hunde etwas beizutragen. Ohne Knechtschaft und Knutte durch eine selbsternannte Elite, die durch Blockadeaktionen jeden anderen Verein an der Ausübung des Sports hintern möchte und nur an deren Mitglieder als Nettozahler interessiert sind. Aufs Stockerl werden Vereinsnomaden eher selten gelassen …
Wo ist also nun der Unterschied zwischen den Nordischen und den Offenen?
Es gibt keinen! Beide Lager sind verbissen, beide Lager streben nur nach Titel und Stockerlplätzen, beide Lager vergessen am Trail, dass sie vorne Lebewesen an den Leinen haben! Der einzige Unterschied den ich vielleicht noch entdecken erwähnen möchte, liegt in den Hunden:
Ein Nordischer weiß wann er sich seine Kräfte einteilen muss, oder Geschwindigkeit rausnehmen muss wenn es zu warm wird, ein “Schlappi” läuft bis er tot umfällt …
All jene die aus dem Rennzirkus ausgestiegen sind, die haben es begriffen! Sie laufen mit ihren Hunden wirklich im Einklang mit der Natur und zum Spaß! Wer das einmal probiert hat, weiß erst, wie schön der Schlittenhundesport sein kann!!
Übrigens, der von einem Splitterverein vor vielen Jahren eingeführte Slogan “Gemeinsam fahren – getrennt werten” hat auch nichts gebracht. Wer will mit seinen gepflegten nordischen Fellträgern mit Stehohren schon auf Trails laufen, die vom Dünnschiss der “Plutos” voll sind, und sich das vielleicht auch noch aufs “Fellmäntelchen” spritzen?